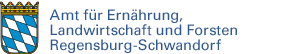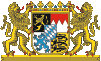Donnerstag, 27. November 2025, 09:00 bis 12:15 Uhr
Online-Forum Kita- und Schulverpflegung - Träger unter sich

© Heike Haas
Die Verpflegung in Kitas und Schulen ist mehr als ein Mittagessen – sie ist ein zentraler Bestandteil des Ganztagskonzepts. Für Träger bedeutet das ständig neue Herausforderungen.
Das Online-Forum Kita- und Schulverpflegung 2025 spannt einen Bogen über die verschiedensten Themen, die für eine gelungene Kita- und Schulverpflegung für Sie als Träger relevant sind. Wir stellen Ihnen u.a. die Möglichkeit des kostenlosen Mittagessens für die Anspruchsberechtigten des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) Außerdem präsentieren wir Ihnen die neue digitale Plattform "Unser Schulessen", die sowohl Sie als Träger als auch Schulen künftig beim Qualitätsmanagement der Schulverpflegung praxisnah unterstützen kann.
Neben einem Praxisbeispiel wie der Ganztag gelingt, teilt ein Speiseanbieter seine langjährigen Erfahrungen rund um die Kita- und Schulverpflegung mit uns.
Weiterhin sind Vertreter der Regierung Oberpfalz zu Fragen rund um den anstehenden Ganztagsbetreuungsanspruch mit dabei. Diskutieren Sie über Ihre Erfahrungen gemeinsam mit anderen Trägern und knüpfen Sie wertvolle Kontakte.
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit anderen Fachleuten auszutauschen, Best Practices zu teilen und innovative Konzepte zu diskutieren, die den besonderen Anforderungen der Ganztagesbetreuung gerecht werden.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam mit Ihnen die Zukunft der Verpflegung im Ganztag zu gestalten und weiterzuentwickeln.
Träger sowie kommunale Vertreter und Vertreterinnen informieren sich zu aktuellen Themen der Kita- und Schulverpflegung. Um eine gelungene, gesundheitsförderliche Kita- und Schulverpflegung anbieten zu können, stehen insbesondere Praxisbeispiele und ein Erfahrungsaustausch im Vordergrund.
Für das Online-Seminar benötigen Sie:
- Einen Computer/Laptop oder Tablet mit Internetanschluss und einem aktuellen Browser (Firefox, Chrome, Safari oder Edge)
- Ein Mikrofon (Headset oder integriertes Mikrofon am Laptop) ist von Vorteil, wenn Sie während des Seminars z. B. Fragen stellen möchten
Eine Einwahl per Telefon ist möglich, wenn ihr Computer / Laptop keine Lautsprecher hat.
Wir arbeiten im Online-Seminar mit dem Programm Cisco-Webex.
Die Zugangsdaten sowie weitere Informationen zum Ablauf des Online-Seminars und zur technischen Ausstattung erhalten Sie einige Tage vor der Veranstaltung per Mail.
Rückblick
Beim Sachaufwandsträgerforum für Kitas und Schulen im November 2024 informierten Christina Apel und Dr. Katharina Goerg über die Aufgaben und Ziele der Vernetzungsstelle. Eine gute Schulverpflegung setze ausgewogenes und schmackhaftes Essen voraus. Die Gestaltung der Mensa als Wohlfühlort, eine hohe Teilnehmerquote und ein händelbarer Verwaltungsaufwand seien zudem unverzichtbar.
Christina Apel betonte: "Mahlzeit ist Bildungszeit, die pädagogisch begleitet wird." Um das zu erreichen, bewähre sich ein Essensgremium, bei dem alle Akteure mit einbezogen werden.
Erst durch das Miteinander und die gemeinsame Verantwortung für die Verpflegung könne die Aufgabe zufriedenstellend bewältigt werden, berichtete Dr. Katharina Goerg. Bei den Herausforderungen helfe ein durchdachtes Verpflegungskonzept, das in sieben Schritten zum Erfolg führt. Beginnend mit der Zielsetzung und Zeitplanung, über eine umfassende Ist-Analyse, werden dann Essensgremium und politisches Gremium einbezogen. Im fünften Schritt wird schließlich das Verpflegungskonzept verschriftlicht. Abschließend stimmt das Essensgremium ab, gefolgt vom Beschluss des Verpflegungskonzeptes im politischen Gremium.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
© Lara Schwarzenberger
Angefangen hatte die Küche mit 40 bis 50 Essen, mittlerweile sind es 140 täglich. Ein angepasster Speiseplan nach Essensvorlieben ohne vierwöchige Wiederholungen förderte die Akzeptanz bei den Kindern. Islinger berichtete, dass die Essensausgabe nach dem Schüsselsystem erfolgt, das aus einem Essenholer und der Selbstbedienung am Tisch besteht. Das Gemeinschaftsgefühl der Kinder und die Rücksichtnahme gegenüber den anderen Essensteilnehmern wurde durch dieses Konzept bereits deutlich gestärkt.
Ein geringerer Einsatz, ein günstigerer Einkauf und ein geringerer Aufwand bei der Einlagerung und der Kühlung waren bei Islinger die entscheidenden Kriterien für eine vegetarische Küche.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
© Lara Schwarzenberger
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
© Lara Schwarzenberger
Als Problem stellte Boßle dar, dass die DGE-Standards in Städten wesentlich leichter eingehalten werden könnten als im ländlichen Umkreis. Auch der vermehrte Einsatz von Bio-Lebensmitteln sei bisher eher an städtischen Schulen in Regensburg durchgeführt worden.