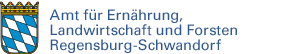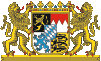AELF informiert über Zwischenfrüchte und Bodenproben in roten Gebieten
Den Boden besser kennen lernen
'Zwischenfrüchte binden Stickstoff und verhindern, dass dieser ins Grundwasser gelangt', erklärte Reinhard Baumer vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Regensburg-Schwandorf am vergangenen Donnerstag in Oberviechtach. Das mache sie gerade in mit Nitrat belasteten Gebieten (sog. Rote Gebiete) notwendig und wertvoll.
Das AELF hatte für Anfang Juni 2024 auf dem Betrieb Hösl zur Vorstellung eines Zwischenfrucht-Schauversuchs eingeladen. Landwirt Johannes Hösl erläuterte Vor- und Nachteile der einzelnen Zwischenfruchtmischungen. Peter Mulzer, Ringwart vom Landeskuratorium für pflanzliche Erzeugung (LKP) Bayern, erläuterte, was beim Ziehen von Nmin-Proben zu beachten ist. Anschließend führte die Raiffeisenwaren und -dienstleistungs GmbH Fensterbach die maschinelle Nmin-Probenahme vor.
Engmaschige Beprobung in roten Gebieten
Grundwasser ist eine unverzichtbare Lebensgrundlage für Mensch und Natur und verdient deshalb besonderen Schutz. Gebiete mit einer hohen Stickstoffbelastung im Grundwasser werden deshalb als sogenannte „mit Nitrat belastete Gebiete“ (rote Gebiete) ausgewiesen. Bei der Neuausweisung wurden die „roten Gebiete“ im nördlichen Landkreis Schwandorf deutlich vergrößert. Dort müssen Landwirte zusätzliche Auflagen bei der Landbewirtschaftung und Düngung erfüllen. Sie haben zum Beispiel den Stickstoffdüngebedarf um 20 Prozent zu reduzieren und unterliegen beim Düngen deutlich strengeren Sperrfristen. Darüber hinaus müssen sie mithilfe von zusätzlichen Bodenproben den Stickstoffgehalt im Boden noch engmaschiger untersuchen und Zwischenfrüchte vor allen Sommerkulturen anbauen, wenn diese im Frühjahr gedüngt werden sollen.
Dienstleister kann beauftragt werden
"Wenn ich beprobe, weiß ich, was auf meiner Fläche an Stickstoff für meine Kultur zur Verfügung steht", hob Patricia Steinbauer vom AELF Regensburg-Schwandorf den Vorteil für die Landwirte hervor. Ist das Bodenuntersuchungsergebnis niedrig, bedeutet das, dass die Zwischenfrucht im Herbst schon viel Stickstoff aufgenommen hat und der Stickstoff effizient verwertet werden konnte. In der Düngebedarfsermittlung darf dieser niedrigere Wert angesetzt werden. Ist der Wert höher, muss der Landwirt weniger düngen, da jede Kultur nur eine bestimmte Menge Stickstoff aufnehmen kann. Er spart sich damit bares Geld.
"Pro Kultur muss in roten Gebieten pro Jahr ein Schlag beprobt werden."
Ringwart Peter Mulzer vom Landeskuratorium für pflanzliche Erzeugung
In der Regel geschieht dies im zeitigen Frühjahr. Anhand dieser Ergebnisse sei es möglich, den Stickstoffdüngebedarf zu den verschiedenen Kulturen im Frühjahr zu ermitteln. Eine Probe besteht aus 15 bis 20 Einstichen, die gleichmäßig über die Fläche verteilt sein müssen. Da eine solche Beprobung viel Kraft und Zeit in Anspruch nimmt, gibt es auch die Möglichkeit, die Proben von einem Dienstleister nehmen zu lassen. Die Raiffeisenwaren und -dienstleistungs GmbH Fensterbach bietet dies an und führte die maschinelle Probenahme vor.
Zwischenfrüchte nehmen Stickstoff auf
Im Herbst niedrig, im Frühjahr hoch – so soll der Stickstoffwert im Boden sein. Dabei helfen die Zwischenfrüchte, erklärt Pflanzenbauberater Reinhard Baumer. Denn Zwischenfrüchte nehmen den Stickstoff, der sich im Herbst noch im Boden befindet, auf, verhindern, dass er ausgewaschen wird, und retten ihn ins Frühjahr hinüber, wo ihn die Folgefrucht aufnehmen kann. Zwischenfrüchte nennt man Pflanzen, die der Landwirt zwischen zwei Hauptfrüchten auf seinen Feldern anbaut. Hat er auf einem Feld im Juli oder August seinen Weizen gedroschen und plant im nächsten Jahr dort Mais anzubauen, kann er dort in der Zwischenzeit die sogenannten Zwischenfrüchte ansäen.
Dazu gehören zum Beispiel Kleesorten, Senf, Grünroggen, Phacelia. Bestimmte Zwischenfrüchte, die sogenannten Leguminosen, binden sogar Stickstoff aus der Luft und können ihn für die folgende Kulturpflanze zur Verfügung stellen. Sind sie auch noch gut gewachsen, schützen sie durch den Zuwachs an Biomasse und die starke Durchwurzelung des Bodens vor Abschwemmung (Erosion) und verbessern die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens (Grundwasserneubildung).
Alles Wissenswerte zur DüV und roten und gelben Gebieten
Neben der Düngeverordnung (DüV) sind für bestimmte Betriebe Vorgaben zum Inverkehrbringen von Wirtschaftsdüngern, den roten und gelben Gebiete oder zur Erstellung einer Stoffstrombilanz relevant. Mehr
Bodenproben ziehen - so geht's